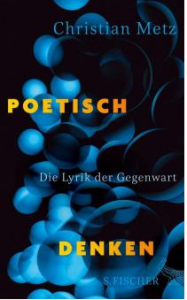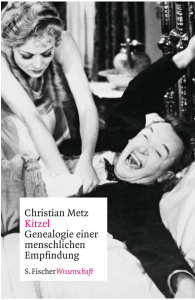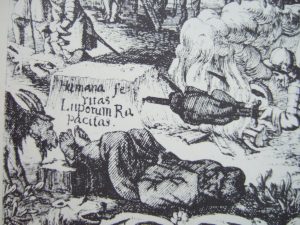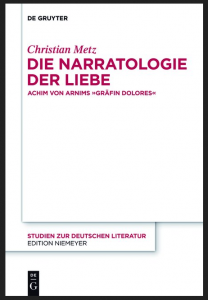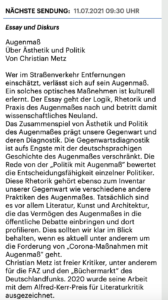Aufsatz: Brüchige Welt. Über Literatur als Reparatur, in: Wespennest. Zeitschrift für brauchbare Bilder und Texte. Zerbrechende (Un-)Ordnungen, Nr. 143. April 2023, S. 61-67.
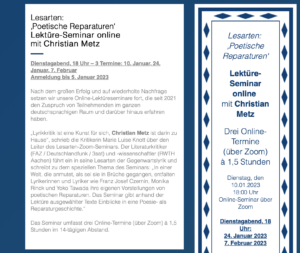
Vortrag / Kolloquium: Literary Repairs. Alexander Kluge and Franz Josef Czernin, Cornell University, German Department am 6.10.2022.
Von Dekonstruktion und Poststrukturalismus aus stellt sich die Frage, inwiefern das Leibliche, Materiale und Asemiotische in die Zeichenhaftigkeit der Kultur hineinragen. Die Theorie der Beugung / Diffraktion eröffnet ein Denkmodell, um diese Figur als Verschränkung zu deuten. Diese Denkweise erlaubt einen neuen Blick nicht zuletzt auf die Poetiken der Dokumentation und des Authentischen, die derzeit die literarische Ästhetik bestimmen. Der Essay zur Theorie der Beugung ist in der lyriktheoretischen Reihe „Edition Poeticon“ des Verlagshauses Berlin erschienen:
Zur Ästhetik der Diffraktion / Beugung im Blick auf die Gegenwartslyrik zudem:
Diffraktive Poetologie. Monika Rincks Poetik des Sprungs. Eine Lektüre, in: Zeitschrift für Germanistik 28 (2018), H. 2, S. 247-260.
Einer Ästhetik der Unschärfe kommt in Fotografie, Film und Malerei seit jeher eine gewichtige Rolle zu. Im Gegensatz dazu wird sie in der Literatur als Marginalie gehandelt. Wurde Sie dort überhaupt beachtet, dann ausschließlich im Zusammenhang intermedialer Inszenierungen. Die Unschärfe bleibt in diesen Fällen ein Fremdkörper innerhalb der Literatur. Unschärfe ist aber sehr wohl auch ein literarisches Phänomen. Sie lässt sich als zeichentheoretische, erzähltheoretische und rhetorische Textfigur definieren. Seit der Frühen Neuzeit, so die These des Forschungsprojekts, kommt der Literatur innerhalb des literarischen Diskurses eine elementare Rolle zu. Als im Übergang vom 17. zum 18. Jahrhundert die Physiologie des Sehens von antiken Vorstellungen losgelöst wird, ruft die unscharfe Wahrnehmung die Frage nach der Erkenntnisfähigkeit des Menschen neu auf. Wissenspoetisch betrachtet, dient die literarische Unschärfe dazu, jene Gebiete des Wissens neu zu kartieren und über die Wissensränder hinweg auch das historisch spezifische Nicht-Wissens zu formieren.
Literarische Unschärfe. Zu ihrer Poetik und ihrem frühneuzeitlichem Debüt bei Klaj und Brockes, in: Zeitschrift für deutsche Philologie (4) 2018, S. 489-518.
Intermedialität im Verschwommenen. Unschärfe in der Kurzprosa und Lyrik der Moderne: MLA Convention, Mediality and Intermediality, unter Leitung von Katja Garloff, 4-7.1.2018, New York City.
Schön ist, wenn der Text verschwimmt? Literarische Unschärfe. Indiana University (Bloomington), am 20.10.2017 (auf Einladung von Prof. Dr. Fritz Breithaupt).
„Was weiter erfolgte, brauchen wir nicht zu melden …“ Heinrich von Kleists „Poetik der
Unschärfe, in: Kleist Special, Forschung Frankfurt (2) 2011, S. 68-69.
http://www.forschung-frankfurt.uni-frankfurt.de/36050770/18Metz.pdf?
http://www.deutschlandfunk.de/poetische-zeichen-der-zeit.1148.de.html?dram:article_id=180811
Wir leben im Zeitalter des Gedichts. Die Poesie ist auf Erfolgskurs, schließlich sind einige der begabtesten Autoren einer ganzen Generation in der Lyrikszene zu finden. Warum das so ist und was die Lyrik der Gegenwart auszeichnet, steht im Zentrum der Forschungsarbeiten und literaturkritischen Beiträge zur heutigen Poesie. Angetrieben von den epochalen Veränderungen unserer Zeit forciert die Lyrik der Gegenwart ein poetisches Denken. Es ist ein Denken mit poetischen Mitteln, das der sinnlichen Erfahrung, der Leidenschaft und dem Spiel Raum gibt. In dieses poetische Denken führen die einzelnen Publikationen systematisch ein.
http://www.fischerverlage.de/buch/poetisch_denken/9783100024404
Das Beste, was einem Buch über Lyrik passieren kann? Es wir zu Lyrik: Hannes Bajohr hat aus „Poetisch denken“ nicht nur ein, sondern gleich vier neue Bücher „Poetisch denken“ gemacht. Großartig! Wie, warum und wofür erläutert er eindrücklich hier:
Beitrag: „Gesang einer gefangenen Amsel (1914)“, in: Trakl-Handbuch. Leben, Werk, Wirkung, hrsg. von Philipp Theisohn, Stuttgart 2023, S. 349-352.
Beitrag: „Aus goldenem Kelch. Barrabas (1906)“: Beitrag zum Trakl-Handbuch, hrsg. von Philipp Theisohn, Stuttgart 2023, S. 141-144.

Aufsatz: Vernetzter Solitarismus. Deutschsprachige Lyrik von 1980 bis 2000, in: Études Germaniques 77 (2022), H. 4, S. 541-558.
Aufsatz: In Sprache gebadet, von bitteren Versen ausgedrückt. Zu Wolfgang Bächlers sprachphilosophischer Poetik, in: Ich trage Erde in mir. Beiträge zum Werk von Wolfgang Bächler, hrsg. v. Waldemar Fromm und Holger Pils, Göttingen 2020, S. 79-100.
Zum Glück! Laudatio aus Anlass von Monika Rincks Poetikvorlesungen „Wirksame Fiktionen. Zwei Vorlesungen über Lyrik zwischen Fiction und Non-Fiction. Lichtenberg-Poetik-Vorlesungen. Göttingen, Zentrum für Literatur, 30.1.2019.
Planetarische Kollektive. Zusammenarbeit als Konstellation. Keynote zum Symposion zu „Lyrik und Kollektivität“ an der FU-Berlin, 22.-23.11.2018 (auf Einladung des Friedrich Schlegel Graduierten-Kollegs).
Seit 2016 forsche ich – vor allem in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Zeitungsarchiv Innsbruck – zum Status quo und zur Geschichte der Lyrikkritik. Die Forschungsarbeit ist eng verwoben mit meiner Tätigkeit als Dozent. Regelmäßig halte ich Workshops zur Lyrik- und Literaturkritik:
Im Sowohl-als-auch von Literaturkritik und -wissenschaft. Methodologische Reflexionen aus einem Zwischenraum, in: Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes (67) 2020, H. 3, hrsg. von Frieder von Ammon und Leonhard Herrmann, S. 244-253.
Aufsatz: Im Sowohl-als-auch von Literaturkritik und -wissenschaft. Methodologische Reflexionen aus einem Zwischenraum, in: Gegenwartsliteraturforschung. Positionen – Probleme – Perspektiven, hrsg. v. Frieder von Ammon und Leonhard Herrmann, Mitteilungen des Deutschen Germanistenverbandes 67 (2020), H.3, S. 244-254.
Lyrikkritik in der Kritik. Eintägiger Workshop in der Akademie zur Lyrikkritik im Haus der Poesie, Berlin 19. u. 20. Oktober 2018.
http://www.haus-fuer-poesie.org/de/literaturwerkstatt-berlin/akademiezurlyrikkritik/die-akademie-zur-lyrikkritik
Warum wir eine Wissenschaft der Lyrikkritik brauchen. Und wie sie aussehen könnte. Keynote zur Saisoneröffnung am „Haus der Poesie“ (Berlin) und zur Gründung der Akademie für Lyrikkritik, 14.9.2018, Berlin.
Wertarbeit. Wie die aktuelle Lyrikkritik poetische Qualität bemisst., auf: literaturkritik.at, erschienen am 5. Oktober 2018″ icon=“arrow“ anchor=“Wertarbeit. Wie die aktuelle Lyrikkritik poetische Qualität bemisst., auf: literaturkritik.at, erschienen am 5. Oktober 2018.
http://www.uibk.ac.at/literaturkritik/zeitschrift/wertarbeit.html
Diskurskartographie. Die Lyrikkritik nach 2000, in: Die Gegenstrophe 8, hrsg. von Michael Braun, S. 52-77.
https://www.uibk.ac.at/literaturkritik/zeitschrift/fuenfter-sein.html
2016 Poesiedebatte: Lyrikkritik im Netz. Gemeinsam mit Bertram Reinecke, Stefan Schmitzer, Maren Jäger, Literaturwerkstatt, Haus für Poesie, Berlin.
Kitzeln. Studien zur Kultur eines menschlichen Reizes. erscheint bei: Frankfurt am Main. S. Fischer. Wissenschaft.
https://www.fischerverlage.de/buch/christian_metz_kitzel/9783100024503
Die Studie erschließt ein neues Forschungsfeld, indem sie den Blick auf ein Existential richtet, das jeder kennt, aber kaum jemand beachtet: die Empfindung des Kitzels. Zum Kitzeln liegt bislang weder in der Biologie noch in Literatur- oder Kulturwissenschaft eine eigenständige Monographie vor. In drei ausgreifenden Kapiteln entfaltet die Studie jeweils von der Antike bis in die Gegenwart die Genealogie des Lachkitzels, des sexuellen Kitzels und des sanften Kitzels. Sie nimmt dazu Texten der Philosophie, Medizin, Anthropologie und Literaturgeschichte in den Blick und liefert neue Lesarten von kanonischen Texten wie Platons „Symposion“, Descartes „Leidenschaften der Seele“ oder Jean Pauls „Leben Fibels“. Aus diesen Lektüren entfaltet sich eine Kultur des Kitzels.
https://www.fischerverlage.de/buch/christian_metz_kitzel/9783100024503
Im Gespräch mit Anne Haeming, F.A.S. vom 11.8.2020:
Hörfunk-Interviews zum Kitzel(n) – eine erste Auswahl:
Deutschlandfunkkultur vom 24.6.2020:
Im Gespräch mit Änne Seidel im Deutschlandfunk am 27.7.2020:
Oder ein bisschen länger? WDR 5. Neugier genügt vom 25.6.2020:
Oder in der „Selbstkitzelbefragung“:
Weitere Interviews mit dem BR, HR2, NDR, Das MAGAZIN (Der Tagesanzeiger).
Rezensionen u.a. im Deutschlandfunkkultur, Deutschlandfunk, Die Welt, Der Falter, Zeit Wissen, Philosophie-Magazin, literaturkritik.de.
Gemalt, gefoltert und gelacht. Zur Funktion des Kitzels in der Wirkungsästhetik der Aufklärung,
in: Sachen der Aufklärung, Auswahl der Beiträge zur DGEJ-Jahrestagung 2010 in Halle a. d. Saale, hrsg. von Frauke Berndt und Daniel Fulda, Meiner Verlag, Hamburg 2012, S. 252-262.
http://textundbeat.de/aesthetik-des-kitzels-ein-abend-mit-knut-ebeling/
Schlaglichter auf das Kitzeln als Folter:
Kitzelfolter in Grimmelshausens Simplicissimus:
Der Klassiker: Ziege leckt Fußsohle.
Kitzelfolter bei den Peanuts:
Die Umkehr, neue Hausordnung: Mensch kitzelt Tier
Kitzelfolter im US-Kino.
Der Dokumentarfilm der Regisseure David Farrier und Dylan Reeve über die Machenschaften der Beitreiber einschlägiger Kitzelseiten. www.tickledmovie.com
Die Narratologie der Liebe. Achim von Arnims Gräfin Dolores, Berlin. Walter de Gruyter/Edition Niemeyer, „Studien zur deutschen Literatur“. Hg. Barner, W., Braungart G. u. Wagner-Egelhaaf, M. 453 Seiten.
Die Dissertation erarbeitet Erkenntnisse innerhalb von drei Forschungsgebieten. Erstens trägt sie zur literaturwissenschaftlichen Liebesforschung bei. Sie ergänzt die Vielzahl kulturwissenschaftlicher und diskursanalytischer Liebesstudien um eine erzähltheoretische und zeichentheoretische Methodik. Mit ihrer Liebestheorie trägt sie zweitens zur Historisierung einer post-klassischen Narratologie und Semiologie bei. Das theoretische Modell bietet die Grundlage für eine Geschichte des Liebesromans, die sich von den historischen Erzähl- und Textverfahren statt von den behandelten Inhalten her schreibt. Drittens leistet die Studie einen grundlegenden Beitrag zur Arnimforschung. Bislang galt Achim von Arnims „verwilderter“ Roman „Armut, Reichtum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores. Eine wahre Geschichte zur lehrreichen Unterhaltung armer Fräulein“ als konservativer Liebesroman. Nimmt man ihn aber unter den Prämissen der zuvor entfalteten semiologischen und narratologischen Methodik in den Blick, so entpuppt er sich als ein Metaroman, der das Wissen über die romantische Liebe wie eine literarische Enzyklopädie aufbereitet und das Liebeskonzept einer radikalen Kritik unterzieht. Mit dieser Neubewertung bekommt die „Gräfin Dolores“ eine kardinale Position im literarischen Liebesdiskurs des 19. Jahrhunderts. Die Studie zur Liebesforschung bildet den Ausgangspunkt für weitere Forschungsbeiträge zu historischen Liebeskonzeptionen und zur intimen Kommunikation, die vom 18. Jahrhundert ausgehend bis in die Gegenwart reichen.
Liebe, narratologisch. Sophie von La Roches Geschichte des Fräuleins von Sternheim. Tagung Grenzgänge. Liebe, Trauer, Angst in der Literatur, Ludwig Maximilian Universität, Oktober 2009.
Rhetorik der Unterbrechung. Zur Konstruktion weiblicher Rede in Achim von Arnims Gräfin Dolores, in: Rhetorik. Ein internationales Jahrbuch, Bd. 29, Sonderband „Rhetorik und Gender“, Hg. Doerte Bischoff u. Martina Wagner-Egelhaaf 2011, 78-94.
Warenästhetik, Liebe und literarische Selbstreflexion in Leanne Shaptons Romanexperiment „Bedeutende Objekte“. In: Warenästhetik. Neue Perspektiven auf Konsum, Kultur und Kunst. Hg. Drügh, H., Metz, C., Weyand, B. Berlin. Suhrkamp Verlag. (2011), 269-296.
Lady Gagas digitale Musikästhetik. In: Pop. Zeitschrift für Popkultur. Hg. Baßler, M., Drügh, H., Hecken, T. u.a. 2012 (1), 155-170.
Im Schatten des Erscheinens. Marlene Streeruwitz‘ Semiologie der Liebe. Tagung Allegorien des Liebens. Universität Mainz, 26-27.7.2013.
Dilettantische Ökonomen: Holtrop, Horzon, Sargnagel, in: Die Neue Rundschau (3) 2017, S. 112-128.
Während öffentliche Proteste und außerparlamentarische, politische Bewegungen früher Fabrik- und Büroräume besetzten und damit Karl Marx Logik einer „Aneignung der Produktionsmittel“ folgten, hat sich die Technik der Besetzung inzwischen verändert: die weltweiten Proteste der vergangenen Jahre verbindet – jenseits ihrer inhaltlichen Forderungen – eine Gemeinsamkeit: Sie bestehen in der Besetzung eines öffentlichen Platzes, der zur Bühne eines öffentlichen Schauspiels umkodiert wird. Auf dieser Bühne folgt dann die performative Aufführung von neuen Gesellschaftsformen und Lebensweisen. Die Bilder dieser Inszenierungen finden ihrerseits höchste Aufmerksamkeit im digitalen Raum. Sie sind für die Publikation im Netz gemacht und werden durch die Verwendung von SMS, Twitter oder Kommunikation im „deep web“ getragen. Auf diesen ineinander verschränkten Ebenen folgt die Politik des besetzten Platzes ästhetischen Prämissen und Strategien, die es zu untersuchen gilt. Das Forschungsprojekt widmet sich der Geschichte, Kultur und Ästhetik besetzter Plätze. Was bedeutet es, dass politischer Protest ausgerechnet in der Besetzung (nicht immer) zentraler Plätze äußert? Woraus begründet sich diese Protestform? Welche Vorbilder und Traditionen gibt es? Historischer Ausgangspunkt der Überlegungen bilden drei antike Texte: Homers „Odyssee“, in welcher die Freier den Platz des irrfahrenden Odysseus einzunehmen suchen. Aristoteles’ Lehre vom „horror vacui“, bei dem die Angst vor dem leeren Platz umgeht, und Aristophanes „Weibervolksversammlung“, bei dem die Frauen den angestammten Platz der Männer einnehmen. Die Forschungsarbeit widmet sich Elias Canettis „Masse und Macht“, streift – weil sich große Firmen die Strategien der Platzbesetzung ihrerseits angeeignet haben – mit Friedrich von Borries durch „Niketown“ und untersucht verschiedene Platzbesetzungen. Vor allem aber nimmt sie die Occupy-Bewegung in den Blick.
Im Zentrum dieser Forschungsarbeit steht die politische Poetik der österreichischen Autorin Marlene Streeruwitz. Die wissenschaftliche und literaturkritische Auseinandersetzung mit ihren literarischen Arbeiten setzt mit einer Rezension zu „Die Schmerzmacherin“ ein, setzt sich über Moderationen und öffentliche Gespräche mit der Autorin bis zu dem Interview fort, das Marlene Streeruwitz’s Neuherausgabe ihrer Poetik-Vorlesungen begleitet, und umfasst zudem einen Vortrag zur Politik der Liebe in ihren literarischen Texten.
2012 Marlene Streeruwitz, Die Schmerzmacherin, LiteraTurm, Frankfurt
2013 Romantikfestival Frankfurt: Das Ding, das schmerzen macht: Die romantische Liebe. Gespräch mit Marlene Streeruwitz u. Monika Rinck
2013 Marlene Streeruwitz, Werkschau, Theater St. Pölten
2013 Marlene Streeruwitz LCB Berlin
Nachwort und Interview mit Marlene Streeruwitz zur Neuherausgabe ihrer Tübinger und
Frankfurter Poetikvorlesungen,in: Marlene Streeruwitz, Poetik, Frankfurt am Main 2014
http://www.fischerverlage.de/buch/poetik/9783596196210
Gespräch mit Marlene Streeruwitz:
http://www.hundertvierzehn.de/artikel/marlene-streeruwitz-im-gespr%C3%A4ch-mit-christian-metz_231.html
Im Schatten des Erscheinens. Marlene Streeruwitz‘ Semiologie der Liebe. Tagung Allegorien des Liebens. Universität Mainz, 26-27.7.2013.
MONOGRAFIEN
Kitzel. Genealogie einer menschlichen Empfindung, S. Fischer Wissenschaft, Frankfurt am Main 2020.
Beugung. Poetik der Dokumentation. Edition Poeticon, Verlagshaus Berlin. Berlin 2020.
Poetisch denken. Die Lyrik der Gegenwart, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2018.
Die Narratologie der Liebe. Achim von Arnims Gräfin Dolores, Walter de Gruyter/Edition Niemeyer, „Studien zur deutschen Literatur“, hrsg. von Winfried Barner, Georg Braungart u. Martina Wagner-Egelhaaf, Berlin 2012.
Schloss Homburg. Edition der Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Hessen, Regensburg, Verlag Schnell und Steiner 2005.
HERAUSGEBERSCHAFTEN
Gegenwartsliteratur! Die Neue Rundschau. Gemeinsam mit Ina Hartwig und Oliver Vogel. S. Fischer Verlag, Frankfurt 2015.
Döblins Erzählungen. Gemeinsam mit Heinz Drügh. S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2012.
Warenästhetik. Neue Perspektiven auf Konsum, Kultur und Kunst. Gemeinsam mit Heinz Drügh und Björn Weyand, Suhrkamp Verlag, Berlin 2011.
Weimarer Klassik. Das große Lesebuch. Gemeinsam mit Heinz Drügh, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2009.
Die schönsten Liebesgeschichten, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2009.
Schön ist mein Garten. Ein literarischer Streifzug, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2009.
AUFSÄTZE
Aufsatz: Liturgische Verschwommenheit. Unschärfe-Inszenierungen liturgischer Sprache, in: Jan Mathis und Gerald Kretzschmar (Hg.): Versprochen. Interdisziplinäre Zugänge zur liturgischen Sprache. Im Auftrag des Zentrums für evangelische Gottesdienst und Predigtkultur, Leipzig 2022, S. 51-77.
Aufsatz: Celans Lachen, in: Evelyn Dueck und Sandro Zanetti (Hg.): Mitdenken. Celans Theorie der Dichtung heute, Heidelberg 2022, S. 161-176.
Aufsatz: Prekäres Gleichgewicht. Zu Jan Wagners Figuren der Balance, in: Friedhelm Marx, Holger Pils u. Christoph Jürgensen (Hg.), Das literarische Werk Jan Wagners, Würzburg 2022, S. 145-155.
Aufsatz: Kurt Drawert, Idylle rückwärts, in: Kindlers Literatur Lexikon, erschienen 2022.
Im Sowohl-Als auch von Literaturkritik und -wissenschaft. Methodologische Reflexionen aus einem Zwischenraum. DGV Sonderheft „Gegenwartsliteraturforschung, hrsg. von Frieder von Ammon und Leonhard Herrmann 67 (2020), H 3., S. 244-254.
In Sprache gebadet, von bitteren Versen ausgedrückt. Zu Wolfgang Bächlers sprachphilosophischer Poetik, in: Wolfgang Fromm u. Holger Pils (Hg.), Ich trage Erde in mir. Beiträge zum Werk von Wolfgang Bächler. Göttingen 2020, S. 79-100.
Super Bücher, super Leser, Supermarkt. Zum Wert der Gegenwartsliteratur, in: Jahrbuch der Bayerischen Akademie der schönen Künste. Was ist der Wert der Kunst, auf Einladung von Michael Krüger, München (2019) 33, erschienen: Göttingen 2020, S. 42-65.
Literarische Unschärfe. Zu ihrer Poetik und ihrem frühneuzeitlichen Debüt, Zeitschrift für Deutsche Philologie (137), 2018, H 4, S. 489-518 (peer reviewed).
Wertarbeit. Wie die aktuelle Lyrikkritik poetische Qualität bemisst., auf: literaturkritik.at, erschienen am 5. Oktober 2018 (https://www.uibk.ac.at/literaturkritik/zeitschrift/wertarbeit.html).
Diffraktive Poetologie. Monika Rincks Poetik des Sprungs. Eine Lektüre, in: Zeitschrift für Germanistik 28 (2018), H. 2, S. 247-260.
Ökonomische Dilettanten: Holtrop, Horzon, Sargnagel, in: Sonderband: Strategischer Dilettantismus. Die Neue Rundschau, hrsg. von Uwe Wirth, Frankfurt 2017, S. 112-129.
Ich seh’ etwas, was du nicht bist. Heinrich von Kleists „Poetik der Unschärfe, in: Ernst Volland, Eingebrannte Bilder, Berlin 2018, S. 90-92.
Diskurskartographie. Die Lyrikkritik nach 2000, in: Die Gegenstrophe 8, hrsg. von Michael Braun, S. 52-77.
Warum die Engel auf sich warten lassen. Zur Inszenierung der Unschärfe in der Ostererzählung des Johannes-Evangeliums, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15. April 2017.
Fünfter sein. Vergessen wir nicht die Lyrikkritik. Zum Status quo der Lyrikkritik, in: Literaturkritik.at, 31.10.2016 (Aufsatz umfasst knapp 30 Druckseiten).
Nachwort als Interview mit Marlene Streeruwitz zur Neuherausgabe ihrer Tübinger und Frankfurter Poetikvorlesungen, in: Marlene Streeruwitz, Poetik, Frankfurt am Main 2014.
Lady Gagas digitale Musikästhetik, in: Zeitschrift für Popkultur, hrsg. von Moritz Baßler, Heinz Drügh, Thomas Hecken u.a. (1) 2012, S. 155-170 (Peer reviewed).
Gemalt, gefoltert und gelacht. Zur Funktion des Kitzels in der Wirkungsästhetik der Aufklärung, in: Frauke Berndt u. Daniel Fulda, Sachen der Aufklärung, Auswahl der Beiträge zur DGEJ-Jahrestagung 2010 in Halle a. d. Saale, hrsg. von Frauke Berndt und Daniel Fulda, Meiner Verlag, Hamburg 2012, S. 252-262 (peer reviewed).
Die Tänzerin und ihr Leib. Nachwort gemeinsam mit Heinz Drügh zu „Die Ermordung einer Butterblume. Döblins Erzählungen“, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main, 2012, S. 617-637
„Was weiter erfolgte, brauchen wir nicht zu melden ...“ Heinrich von Kleists „Poetik der Unschärfe, in: Kleist Special, Forschung Frankfurt (2) 2011, S. 68-69.
Warenästhetik, Liebe und literarische Selbstreflexion in Leanne Shaptons Romanexperiment „Bedeutende Objekte“, in: Warenästhetik. Neue Perspektiven auf Konsum, Kultur und Kunst, hrsg. von Heinz Drügh, Björn Weyand u. Christian Metz, Suhrkamp Verlag, Berlin 2011, S. 269-296.
Lustvolle Lektüre. Zur Narratologie und Semiologie der Literaturausstellung, in: Wort-Räume, Zeichen-Wechsel, Augen-Poesie. Zur Theorie und Praxis von Literaturausstellungen, hrsg. von Anne Bohnenkamp-Renken u. Sonja Vandenrath, Wallstein Verlag, Göttingen 2011, S. 87-99.
„Lyrik der Verzweiflung.“ Brinkmanns „Gedicht ‚Nacht’“, in: Rolf Dieter Brinkmann. Seine Gedichte in Einzelinterpretationen, Bd. 1, hrsg. von Gunter Geduldig u. Jan Röhnert, Walter die Gruyter, Berlin 2012, S. 294-306.
Medientheoretische Grundlagen. Buch, Druck, Schrift, in: Germanistik. Sprachwissenschaft, Literaturwissenschaft, Schlüsselqualifikationen, hrsg. von Heinz Drügh, Susanne Komfort-Hein, Andreas Krass, u.a, Metzler Verlag, Stuttgart 2012, S. 203-209.
Rhetorik der Unterbrechung. Zur Konstruktion weiblicher Rede in Achim von Arnims Gräfin Dolores, in: Rhetorik. Ein internationales Jahrbuch, Bd. 29, Sonderband „Rhetorik und Gender“, hrsg. von Doerte Bischoff u. Martina Wagner-Egelhaaf 2011, S. 78-94.
Vorwort zu „Weimarer Klassik. Das große Lesebuch“. Gemeinsam mit Prof. Dr. Heinz Drügh, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2009.
VORTRÄGE
Hölderlins „Homburger Folio“. Ein Streifzug durch Homburgs berühmteste literarische Landschaft. Gemeinsam mit Sandra Kegel (Leiterin Feuilleton der F.A.Z.), Schloss Homburg, auf Einladung der Verwaltung der Hessischen Schlösser und Gärten, 7. Juni 2021.
Verfährt Monika Rincks Lyrik wissenschaftlicher als die Literaturwissenschaft? Respondenz auf der Tagung: Monika Rinck und die Gegenwartsliteratur an der Goethe Universität Frankfurt, 4.12.2020.
Im Stile der Verletzlichkeit. Zur Konstruktion von Intimität in Twitter-, Whatsapp-, Instagram-Literatur, Vortrag auf de Tagung: Neue Nachbarschaften. Stil und Social Media in der Gegenwartsliteratur, ZFL Berlin, 20.11.2020.
Langsamer Fallen. Oder die Idee des Sturzes vollständig aufgeben? Laudatio auf den Lyriker Levin Westermann. Zur Verleihung des Clemens Brentano-Preises der Stadt Heidelberg am 28.10.2020.
Reiseunheimlichkeit. Poetische Texturen im Resonanzraum von Gernhardts Schreiben. Zur Verleihung des Robert-Gernhardts Preises durch das Hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst an Fatma Aydemir, Sven Amtsberg und Thomas Hettche, Wiesbaden, 13.8.2020.
Literaturkritik. Einblicke in eine literaturpraktische Arbeitsform. Gastvortrag an der Universität Leipzig, auf Einladung von Herrn Prof. Dr. Frieder von Ammon, 25.6.2020.
Alles hat seinen Preis. Die Lyrik hat viele. Zur Valorisierungsdynamik im poetischen Preissystem, an der Universität Duisburg-Essen, 18./19. Juni 2020, auf Einladung von Frau Prof. Dr. Alexandra Pontzen (Vom Veranstalter abgesagt).
Prekäres Gleichgewicht. Jan Wagners Figuren der Balance. Tagung zur Poetikdozentur von Jan Wagner an der Universität Bamberg, 17./18. Juni 2020, auf Einladung von Prof. Dr. Friedhelm Marx, gehalten am: 11.1.2021.
Vernetzte Solitäre. Deutschsprachige Lyrik der 1990er, Eröffnungsvortrag zur Tagung „Poetische Netzwerke“ an der Universität Metz. Konferenz der Deutsch-Französischen Wissenschaftskooperation „Poetische Netzwerke!“, 20./21. April 2020, auf Einladung von Achim Geisenhanslüke, gehalten am: 23.April 2021 in Metz (Frankreich).
Gegenwartslyrik. Literaturhistorisch, Praxeologisch, Kulturwissenschaftlich. Fachverband Deutsch in Berlin-Brandenburg, Vortrag und anschließendes Gespräch mit Nico Bleutge und Ann Cotten am 23.10.2019.
Diffraktion. Zu Kathrin Rögglas und Marlene Streeruwitz’ Reflexionskritik. Vortrag an der LMU-München. Konferenz „Something Weird“- Eine Tendenz der Gegenwartsliteratur am 12.9.2019.
Poetic thinking or: Why the best German Writers today are Poets. Vortrag an der University of Berkeley (USA), auf Einladung von Robert Kaufman, 4.9.2019.
Diffractional Poetry. Vortrag am Occidental College, Los Angeles (USA), auf Einladung von Prof. Dr. Stephen Klemm, 28.8.2019.
Warum Lyrik? Eröffnungsvortrag des 21. Internationalen Lyrikertreffens Münster. Theater Münster, 24.5.2019.
Super Bücher, super Leser, Supermarkt. Zum Wert der Literatur. Vortrag in der Bayerischen Akademie der schönen Künste. Einführung: Michael Krüger, München, 9.4.2019.
„Ro-ro-ro-romance.“ Zur Aktualität romantischer Lyrik in Popkultur und Gegenwartspoesie: Forum Lyrik. Frankfurt am Main, 9.3.2019.
In Sprache gebadet, von bitteren Versen ausgedrückt. Zu Wolfgang Bächlers sprachphilosophischer Poetik. Tagung: So wechseln die Zeiten ihr Gesicht. Ein Tag für Wolfgang Bächler (1925-2007), Lyrik Kabinett München 8.2.2019.
Zum Glück! Laudatio aus Anlass von Monika Rincks Poetikvorlesungen „Wirksame Fiktionen. Zwei Vorlesungen über Lyrik zwischen Fiction und Non-Fiction. Lichtenberg-Poetik-Vorlesungen. Göttingen, Zentrum für Literatur, 30.1.2019.
Achilles Heel. The Tickle of Violence: MLA Convention, Panel: Emotive Forces, unter Leitung von Anette Schwarz (Cornell University), 4-7.1.2019, Chicago.
Planetarische Kollektive. Zusammenarbeit als Konstellation. Keynote zum Symposion zu „Lyrik und Kollektivität“ an der FU-Berlin, 22.-23.11.2018 (auf Einladung des Friedrich Schlegel Graduierten-Kollegs).
Poetisch denken. Die Lyrik der Gegenwart. Frankfurter Premiere. Moderiert von Georg Dotzauer (Tagesspiegel), Villa Metzler, Frankfurt, 5. Oktober 2018.
Lyrikkritik in der Kritik, Akademie zur Lyrikkritik im Haus der Poesie, Berlin 19. u. 20. Oktober 2018.
Warum wir eine Wissenschaft der Lyrikkritik brauchen. Und wie sie aussehen könnte. Keynote zur Saisoneröffnung am „Haus der Poesie“ (Berlin) und zur Gründung der Akademie für Lyrikkritik, 14.9.2018, Berlin.
Diffractional Realism: German Studies Association. 41 Annual Conference, Panel „Realism and Realist Literature“, unter Leitung von Frauke Berndt (Universität Zürich) und Dorothea von Mücke (Columbia University, NYC), Pittsburgh, 27.-30 September 2018.
Wertarbeit. Wie die aktuelle Lyrikkritik poetische Qualität bemisst. Probevortrag für die Position der Professur Neuere Deutsche Literatur / Literaturvermittlung, Universität Bamberg, 25.6.2018.
„Hilfe, meine Erinnerung besteht aus unscharfen Bildern“. Vortrag auf der Netzwerktagung der Alexander von Humboldt-Stiftung, Regensburg, 27. April 2018.
Intermedialität im Verschwommenen. Unschärfe in der Kurzprosa und Lyrik der Moderne: MLA Convention, Mediality and Intermediality, unter Leitung von Katja Garloff (Reed College), 4-7.1.2018, New York City.
Gegenwartslyrik. Warum die begabtesten deutschsprachigen Autoren nach 2000 Gedichte schreiben. University Chicago, am 27.11.2017 (auf Einladung von Prof. Dr. David Wellbery).
Literary Blurriness. Indiana University (Bloomington), am 20.10.2017 (auf Einladung von Prof. Dr. Fritz Breithaupt).
Literarische Unschärfe. Vortrag im Rahmen von: Conceptual Clarity and Blurred Vision. Details in Early Modern and Romantic Thinking. Workshop an der Yale University., 21.4.2017.
Gegenwartslyrik. Warum die begabtesten deutschsprachigen Autoren nach 2000 Gedichte schreiben. Vortrag im „Deutschen Haus“, 13.4.2017, Columbia University New York City (auf Einladung von Mark Anderson).
Book Reviews. What they are and how to write one. Journalistic Workshop. Literaturkritik. Workshop zu einer journalistischen Schreibweise. 23.3.2017 und 28.4.2017, Cornell-University.
Literarische Unschärfe. Ihre Poetik und ihrem frühneuzeitlichen Debüt. German Department, 24.2.2017, Cornell University.
Stottern als ästhetische Strategie. Kompaktseminar gemeinsam mit Kathrin Röggla „Writer in Residence“, 2.9.2016, Cornell University.
Poetik der Unschärfe. Johann Klajs „Auferstehung Jesu Christi“ und Barthold Heinrich Brockes „Die Seifenfblase“, Universität Siegen, 11.2.2104.
Im Schatten des Erscheinens. Marlene Streeruwitz‘ Semiologie der Liebe. Tagung Allegorien des Liebens. Universität Mainz, 26-27.7.2013.
Zur Auslöschung kritischer Positionen. Die Universität als Narrativ, Goethe-Universität, Frankfurt am Main, März 2013.
Gemalt, gefoltert und gelacht. Zur Funktion des Kitzels in der Wirkungsästhetik der Aufklärung. Sachen der Aufklärung, Jahrestagung der DGEJ 2010 in Halle a. d. Saale.
Kitzel. Zur Kulturgeschichte eines menschlichen Reizes. Raum für Kultur. Commerzbank, Frankfurt am Main, Oktober 2010.
Geheimniskrämer. Zur Ökonomie des Krieges in Christian Krachts Roman „Ich werde hier sein im Sonnenschein und im Schatten“. Goethe Universität Frankfurt am Main, Juni 2010.
Liebe, narratologisch. Sophie von La Roches Geschichte des Fräuleins von Sternheim. Tagung Grenzgänge. Liebe, Trauer, Angst in der Literatur, Ludwig Maximilian Universität, 2009.
Aufwachräume – Deutschsprachige Lyrik der Gegenwart. Universität Tromsø, 2. Oktober 2007.
Eine Charakterfrage. Zum Ursprung der Faszination in Lessings Miss Sara Sampson. Tagung Faszination. Zur historischen Konjunktur und heuristischen Tragweite eines Begriffs. Humboldt-Universität Berlin, Dezember 2007.